Bericht vom 3. Deutschen Hirntag
Am 28.03.2025 fand in der Sparkassenakademie in Stuttgart der 3. Deutsche Hirntag mit dem Thema „Ethik in der Politik und Ethik in der Medizin“ statt.
Einige neue Gesetze (IPReG, AKI-Richtlinie, Krankenhausreform u.a.) haben gravierende Auswirkungen auf das Leben und die Lebensqualität unserer schwerstbetroffenen Angehörigen. Wachkomapatienten sind keine Sterbenden und auch Patienten mit außerklinischer Beatmung haben ein Recht auf eine gute medizinische und pflegerische Versorgung zur Aufrechterhaltung ihrer Lebensqualität einschließlich der freien Wahl des Versorgungs- und Wohnortes.
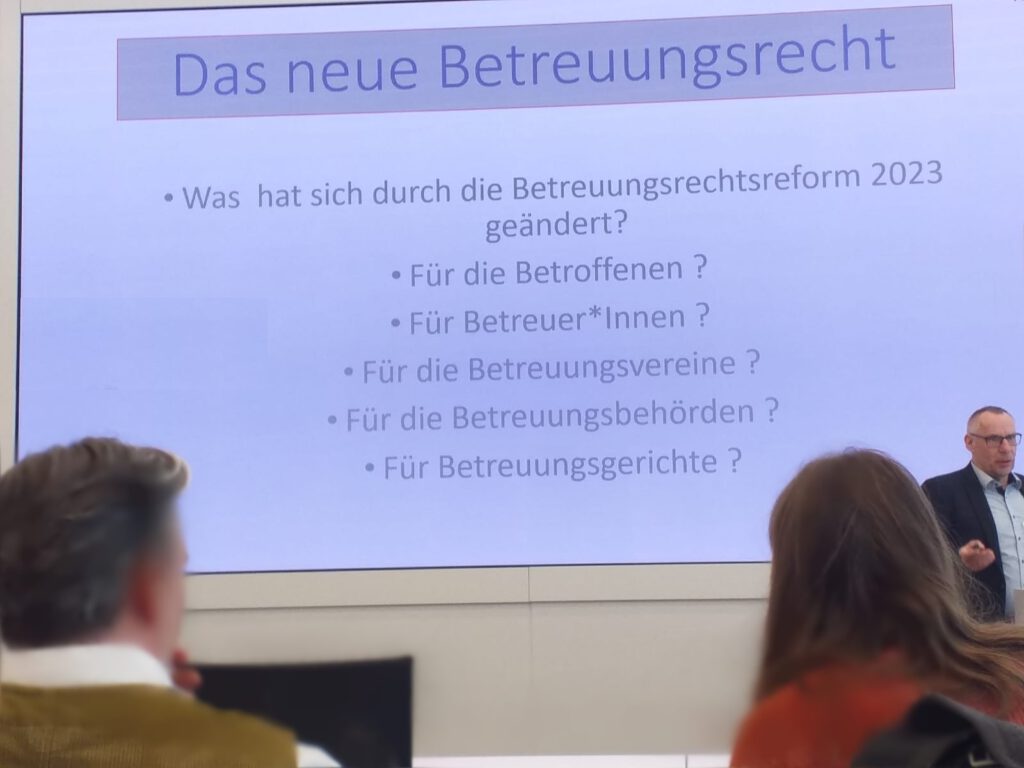
Nicht nur die häusliche Pflege von Intensivpflegepatienten war und ist bedroht, sondern auch die Unterbringungsmöglichkeit von neurologisch schwerstgeschädigten Menschen ohne Tracheostoma und Beatmung in Spezialpflegeeinrichtungen der sog. Phase F. Wie die Angehörigen eine angemessene Versorgung und eine gute Versorgungsmöglichkeit für ihre Betroffenen erreichen können und welche Hilfestellungen und Unterstützungsmöglichkeiten unser Selbsthilfeverband ihnen (u.a. durch die Einflussnahme auf gesundheitspolitische Entscheidungen) bietet, hat Sebastian Lemme in seinen Vortrag dargelegt.
Martin Kristen, der Geschäftsführer des Betreuungsvereins Weimar e.V., informierte die Teilnehmer sehr ausführlich über die Neuerungen im Betreuungsrecht.
Wenn ein Mensch infolge eines Unfalls oder einer Erkrankung die eigenen rechtlichen Angelegenheiten nicht (mehr) selbst erledigen kann und keine oder keine ausreichende Vorsorgevollmacht erteilt wurde, kann das Gericht einen rechtlichen Betreuer bestellen. Das seit 1. Januar 2023 geltende reformierte Betreuungsrecht stellt die Wünsche des Betreuten in den Mittelpunkt aller Entscheidungen, die ein Betreuer im Rahmen des gerichtlich bestimmten Aufgabenkreises trifft und umsetzt. Die Feststellung der Wünsche des Betreuten ist die Pflicht des Betreuers. Sofern diese Wünsche nicht festgestellt werden können, muss der mutmaßliche Wille ermittelt werden.
Neu ist auch die gegenseitige Vertretung von Ehegatten in Angelegenheiten der Gesundheitssorge zur Vermeidung eines eiligen Betreuungsverfahrens, das sog. Ehegatten-Notvertretungsrecht. Dies gilt, wenn ein Ehegatte einwilligungsunfähig ist. Es ist auf 6 Monate begrenzt. Auch hier muss eine Patientenverfügung und der mutmaßliche Wille des Ehegatten beachtet und durchgesetzt werden. Eine weitere wichtige Neuerung ist die Pflicht der Betreuungsbehörde zur Bereitstellung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten, speziell für ehrenamtliche Betreuer.
Am Nachmittag führte Karl-Eugen Siegel die Anwesenden in die Themen Wachkoma, Hirntod und Organspende ein.
Das Wachkoma ist definiert als ein Zustand schwerster Bewusstlosigkeit, während der Hirntod den irreversiblen Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen, einschließlich des Hirnstamms, bezeichnet. Am Beispiel seiner Frau, die zunächst zehn Tage im Wachkoma lag und anschließend für hirntot erklärt wurde, beschrieb er, dass der sichtbare Unterschied zwischen beiden Zuständen marginal sei. Selbst im Zustand des Hirntodes schien für ihn – ebenso wie für Pflegekräfte, Therapeuten und die behandelnden Ärzte – die Präsenz seiner Frau spürbar. Auch das Monitoring vermittelte weiterhin eine Form der Anwesenheit.
Anschließend führte uns Dr. jur. Rainer Beckmann in die Grundprobleme eines schlüssigen Todeskonzeptes ein. Er widmete seinen Vortrag der Frage: „Wann ist der Mensch tot?“
Früher war der „Herztod“ der Tod eines Menschen. Seit den 1950er Jahren kann der einfache Kreislaufstillstand durch „Reanimationstechniken“ rückgängig gemacht werden. In den 1960er Jahren wurde dann das „Hirntod“-Konzept entwickelt. Nach diesem Konzept soll aber nur der isolierte Funktionsausfall des Gehirns entscheidend für die Feststellung des Todes eines Menschen sein. Logisch wäre aber, den Ausfall von Atmung, Kreislauf und Gehirn zu fordern. Aber für eine Organspende müssen die potentiellen Spender künstlich beatmet werden, damit die Organe weiter mit Sauerstoff versorgt werden. Denn ohne künstliche Beatmung würde auf den Hirntod zeitnah der Herz-Kreislauf-Stillstand folgen. Dann ist der Mensch wirklich tot, aber die Organe können nicht mehr transplantiert werden. Ein ethisches Dilemma!
Angehörige von Wachkoma-Patienten sehen sich zunehmend mit Fragen zur Organspende konfrontiert, obwohl in vielen Fällen keine Hirntoddiagnostik erfolgt ist.
Der letzte Vortrag von Dr. jur. Rainer Beckmann widmete sich der Patientenverfügung. Garantiert sie uns eine Selbstbestimmung bis zum Lebensende?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, seinen Willen für den Fall der eigenen Einwilligungsunfähigkeit vorab festzulegen. Das ist die Vorsorgevollmacht, die festlegt, wer welche Angelegenheiten für mich entscheiden darf. Mit einer Patientenverfügung wird festgelegt, was im Krankheitsfall geschehen oder auch nicht gemacht werden soll. Dann gibt es noch die Betreuungsverfügung, die die Wünsche im Falle einer Betreuung auflistet bzw. wo festgelegt werden kann, wer die Betreuung übernehmen und wer auf keinen Fall der Betreuer sein soll.
Sofern der Mensch einen Angehörigen oder einen Freund hat, dem er 100 prozentiges Vertrauen schenkt, sollte er dieser Person eine Vorsorgevollmacht ausstellen. Dann kann auf die Bestellung eines Betreuers verzichtet werden und evtl. auch auf eine Patientenverfügung. Wenn die Vorsorgevollmacht alles umfasst, dann kann auch die Vertrauensperson über Behandlungswünsche bzw. Behandlungsverzicht entscheiden, sofern sie den Willen des Vollmachtgebers kennt und ihn dann auch hoffentlich beachtet.
Leider kann man nicht sicher sein, ob man alles bedacht hat oder ob man sich in der Vertrauensperson geirrt hat. Aber das Leben ist immer ein Risiko und wann und wie unser Leben zu Ende geht bzw. was danach geschieht, wissen wir nicht. Und das möchte ich auch heute noch gar nicht wissen!
Es waren durchaus schwierige Themen, die auf diesem Hirntag behandelt und diskutiert wurden. Trotzdem hoffe ich, dass die Teilnehmer viel Wissenswertes erfahren haben und die neuen Erkenntnisse dazu beitragen, dass sie die richtigen Entscheidungen für ihr Leben und das ihrer Angehörigen treffen werden.
Unser Dank gilt den Referenten für die interessanten und sehr informativen Vorträge und den Krankenkassen für die finanzielle Unterstützung durch die Pauschalförderung, ohne die diese Veranstaltung nicht durchführbar gewesen wäre.
Ausführliche Berichte zu den Themen des Hirntages in Stuttgart finden Sie in der nächsten Ausgabe unseres Mitgliedermagazins „dialog“.
Roswitha Stille

















