Anhörung im Gesundheitsausschuss zur Organspendereform
Die Anhörung im Gesundheitsausschuss am 29.Januar 2025 bot kaum neue Argumente für die Widerspruchsregelung – doch ein Beitrag stach heraus: Die eindringlichen Worte von Ulrike Sommer. Ihre persönliche Geschichte, ihr ethisches Dilemma und ihr leidenschaftlicher Appell für das bewusste Ja oder Nein zur Organspende bleiben unvergessen. „Eine Organspende im Leben oder im Tod ist für mich ein unfassbares Geschenk. Und ich finde, man muss wenigstens fragen.“ Warum ihre starke Stimme in den offiziellen Berichten kaum Erwähnung findet und was das über die aktuelle Debatte aussagt, erfahren Sie hier.
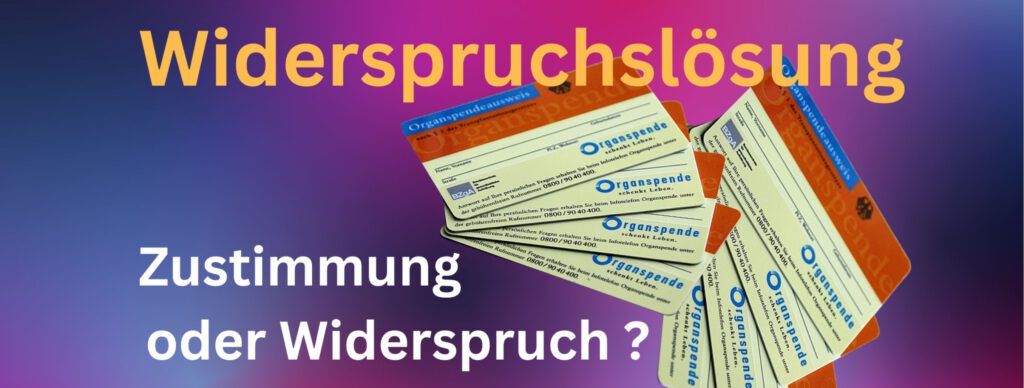
Organspendedebatte: Alte Argumente, wiedergekaut und aufgewärmt
Der Gesundheitsausschuss des Bundestages hat sich im Rahmen einer Expertenanhörung intensiv mit der geplanten Reform der Organspende in Deutschland befasst. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Einführung der Widerspruchsregelung, die vorsieht, dass jeder Bürger grundsätzlich als Organspender gilt, sofern er nicht zu Lebzeiten aktiv widersprochen hat. Während Befürworter dieser Regelung eine höhere Anzahl an Organspenden erwarten, äußerten Kritiker Bedenken hinsichtlich der Selbstbestimmung und ethischer Fragestellungen.
Die Abgeordneten des Bundestages sowie der Bundesrat haben jeweils Gesetzentwürfe vorgelegt, um die Widerspruchsregelung einzuführen. Ziel ist es, die Zahl der Organspenden zu erhöhen, da der aktuelle Bedarf nicht gedeckt werden kann. Der Entwurf sieht vor, dass nicht nur Personen, die aktiv zugestimmt haben, als Spender infrage kommen, sondern auch jene, die nicht ausdrücklich widersprochen haben. Ist kein Widerspruch registriert und gibt es keine gegenteilige Information der Angehörigen, kann eine Organentnahme erfolgen.
Ethische und medizinische Bedenken
Die Medizinethikerin Claudia Wiesemann äußerte Bedenken hinsichtlich der Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Sie wies darauf hin, dass es keine empirischen Beweise gebe, dass die Widerspruchsregelung tatsächlich zu einer signifikanten Zunahme der Organspenden führe. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass die Bereitschaft zur Lebendorganspende zurückgehe. Zudem sei die unzureichende Meldebereitschaft der Krankenhäuser ein wesentliches Problem.
Auch der Theologe und Ethiker Peter Dabrock äußerte sich kritisch. Er argumentierte, dass das Hauptproblem nicht in der Spendenbereitschaft der Bevölkerung liege, sondern in der fehlenden Identifikation potenzieller Spender in Krankenhäusern. Zudem betonte er, dass Schweigen keine Zustimmung bedeuten könne.
Rechtliche Einschätzungen
Der Rechtsexperte Josef Franz Lindner von der Universität Augsburg hielt die Widerspruchsregelung für verfassungskonform. Er betonte, dass der Staat eine Pflicht habe, die Rahmenbedingungen für eine funktionierende Organspende zu schaffen. Hingegen äußerte der Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg verfassungsrechtliche Bedenken und plädierte für eine differenzierte Betrachtung.
Zahlen und Herausforderungen
Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) stagnieren die Organspendezahlen in Deutschland seit Jahren. Im Jahr 2024 gab es 953 Organspender, was im internationalen Vergleich als unzureichend gilt. Derzeit stehen über 8.200 schwer kranke Patienten auf Wartelisten für eine Organspende. Besonders kritisch ist die Situation für Nierenpatienten, von denen viele jahrelang auf eine Transplantation warten.
Der Transplantationsmediziner Bernhard Banas stellte fest, dass frühere gesetzliche Änderungen nicht den gewünschten Effekt auf die Organspendezahlen hatten. Auch das Bündnis Protransplant wies darauf hin, dass bestehende Reformen nicht zu einer Verbesserung geführt hätten. Eine Vertreterin des Bündnisses schilderte in der Anhörung eindringlich das Leid der Wartepatienten, die oft jahrelang ohne Aussicht auf ein Spenderorgan bleiben.
Die Bundesärztekammer (BÄK) sieht in der Widerspruchsregelung eine Möglichkeit, die Diskrepanz zwischen der hohen Spendenbereitschaft in der Bevölkerung und den tatsächlich niedrigen Spenderzahlen zu verringern. Die Entscheidungshoheit der Bürger bleibe gewahrt, da jeder die Möglichkeit habe, aktiv zu widersprechen.
Die Expertenanhörung hat gezeigt, dass es sowohl starke Befürworter als auch kritische Stimmen zur Reform gibt. Der Gesundheitsausschuss wird die Erkenntnisse nun in die weiteren Beratungen des Bundestages einfließen lassen, um über die Zukunft der Organspende in Deutschland zu entscheiden.
Die Anhörung können Sie in der Mediathek des Bundestags abrufen (Bitte etwas herunterscrollen).